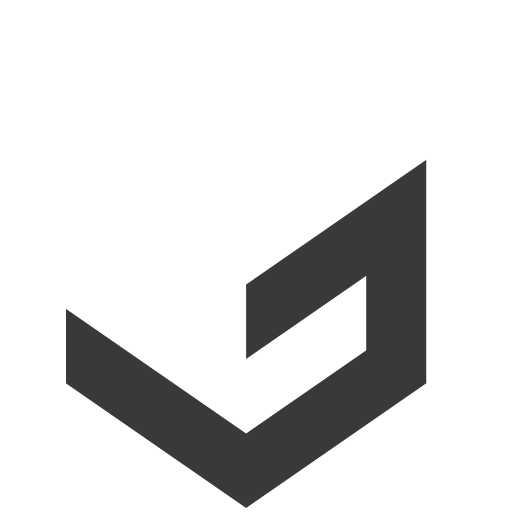Martin Person ist Tonmeister am Deutschen Theater in Berlin. In loser Folge schreibt er über seine Arbeit. In diesem Text geht es um Plugins.
Bereits vor rund 15 Jahren machte ich erste Versuche, Plug-ins im Beschallungsbereich einzusetzen. Bei einer kleineren Diskussionsveranstaltung erschienen mir die Signalbearbeitungsmöglichkeiten des zur Verfügung stehenden analogen Mischpults nicht ausreichend. Deshalb insertierte ich in jeden Mikrofonkanal einen I/O meines eigentlich zu Aufnahmezwecken mitgebrachten Audio-Interfaces. Dieses war ein damals hochaktuelles MOTU 828 in Kombination mit einem Powerbook Titanium (512 MB RAM, 500 MHz!).
Pro Kanal verwendete ich eine „Waves RVox“-Instanz. Als Host-Anwendung diente Logic Audio. Der Rechner war dadurch seinerzeit schon mittelschwer ausgelastet, weshalb ich die System-Latenz aus Sicherheitsgründen bei 256 Samples beließ. Da es sich um eine reine Sprachbeschallung ohne weiteres Monitoring handelte, fiel dies allerdings nicht weiter negativ auf und das Ergebnis überzeugte mich. Aufgrund des nun in jedem Kanal vorhandenen Expanders/ Kompressors war deutlich mehr Gain-before-Feedback möglich und der Sound der acht Tischmikrofone erschien direkter und kompakter.
Virtuelles Siderack
Für ähnliche Veranstaltungen, bei welchen aus Budget-Gründen kein umfangreiches Outboard-Equipment vorzufinden war, nutzte ich fortan regelmäßig mein „virtuelles Siderack“. Bei größeren Gigs oder Musikveranstaltungen war es mir aber doch zu gefährlich – Computer pflegten ja doch ab und an abzustürzen.
In den folgenden Jahren etablierten sich auch in der Beschallung digitale Mischpulte. Dank der nun wesentlich umfangreicher ausgestatteten Kanalzüge – eine vollwertige Dynamics-Sektion war ja zu Analogzeiten nur in absoluten Oberklassemischpulten zu finden – gab es zunächst keine dringende Notwendigkeit mehr, externe Effekte einzusetzen. Selbst Delays und Reverbs standen zum Teil on-board zur Verfügung, so dass unsichere „Bastellösungen“ auf Laptopbasis nicht mehr wirklich schlau erschienen. Eine Ausnahme machte ich allerdings des öfteren: wenn kein hochwertiges externes Hallgerät aufzutreiben war, nutzte ich „Altiverb“ auf dem Rechner. Hier war die Latenz relativ egal und sollte das System einmal abstürzen, so dachte ich mir, verliere ich lediglich kurzzeitig das Reverb – ein vertretbares Risiko.
Rückkehr zum Plug-in
Irgendwann aber, Computer waren inzwischen deutlich schneller und betriebssicherer geworden, begann ich wieder Plug-ins in den Kanalzügen einzusetzen. Auslöser war unter anderem meine Begeisterung über den Multiband-Kompressor „Triple-C“ von T.C. Electronic. Dieser war ja, zumindest in der Theorie, nur ein in Hardware gegossenes Plug-in und ich wollte dessen Fähigkeiten gerne beliebig oft verwenden können. Auf das De-Essing von Sprech- und Gesangssignalen konnte ich nach einem erfolgreichen Versuch mit dem „Waves DeEsser“ ebenfalls kaum mehr verzichten. Zwischenzeitlich war auch das Digidesign (heute: AVID) Venue-System auf den Markt gekommen und verlieh der Nutzung von Plug-ins im Beschallungsbereich ein „seriöseres“ Image.
Heutzutage sind nun schließlich eine Fülle an problemlos im Livebetrieb nutzbaren Plug-ins verfügbar und deren Berechnung kann betriebssicher mittels Soundgrid-Servern oder teilweise sogar direkt auf den Mischpult-DSPs erfolgen. Vom Edel-Kompressor bis hin zum High-End-Reverb – bei sämtlichen Gigs hat man inzwischen mehr Tools an der Hand als es zu Analogzeiten jemals vorstellbar gewesen wäre. Eine durchaus erfreuliche Entwicklung, könnte man meinen, wozu also dieser Text?
Mehr ist mehr?
Nun, vor einiger Zeit kam ich während eines Soundchecks doch ins Grübeln. Ich hatte bereits für jedes Gesangsmikrofon eine beachtliche Plug-in-Chain – bestehend aus Expander, EQ, Vintage-Kompressor und De-Esser – im Insert und fragte mich plötzlich: woran liegt es, dass man vor nicht allzu langer Zeit mit deutlich weniger Signalbearbeitung ebenfalls ein subjektiv gutes Resultat erzielen konnte?
Sicherlich spielen veränderte Hörgewohnheiten und -ansprüche eine Rolle. Was vor 30 Jahren als solider Gitarrensound durchging, würde heute kaum noch die Erwartungen erfüllen. Ebenso will sicherlich niemand zum plärrigen Mikrofonsound früherer Pressekonferenzen zurückkehren. Handelt es sich also um eine sukzessive Evolution unserer Wahrnehmung, so dass es nicht verwunderlich erscheint, wenn dadurch der individuell betriebene Aufwand nach und nach ansteigt? Spielt dabei eventuell auch die gestiegene Qualität im Lautsprecher-Bereich eine Rolle, wodurch gewisse Nuancen in den Audiosignalen deutlicher wahrnehmbar sind? Oder bildet man sich in erster Linie nur ein, dass es besser klingt, wenn man mehr in das Signal eingreift?
Zuviel Processing schadet dem Mix
Es ist doch nämlich auch so, dachte ich: angesichts der vielfältigen Signalbearbeitungsmöglichkeiten läuft man schnell Gefahr, sich zu verzetteln und die Klangqualität einzelner Signale durch zuviel Processing möglicherweise negativ zu beeinflussen.
Nachdem mir dies bewusst geworden war, habe ich mir endlich angewöhnt, bei Soundchecks hin und wieder alle Insert-Effekte auf Bypass zu schalten, um zu prüfen, inwieweit sich die Audioqualität positiv, negativ oder überhaupt verändert (manchmal ändert sich ja nur der Pegel durch falsch eingestellte Make-up-Gains!). Dabei musste ich erst letzthin feststellen, dass ein Gesangsmikro, welches von zwei Sängerinnen abwechselnd genutzt wurde, ohne zusätzliches Signalprocessing durchaus besser klang – zumindest bei einer von beiden.
Alles in allem: Das virtuelle Siderack gehört dazu
Unterm Strich möchte ich auf mein „virtuelles Siderack“ dennoch nicht mehr verzichten. Die Möglichkeiten der Klanggestaltung und – hoffentlich auch – Klangverbesserung sind enorm und gleichzeitig weit oberhalb dessen, was noch vor einigen Jahren – selbst bei höchsten Produktionsbudgets – denkbar gewesen wäre. Nebenbei sind die Anschaffungskosten recht überschaubar und sorgen dafür, dass guter Sound für alle Veranstaltungsgrößen und Tontechniker-Portemonnaies erschwinglich geworden ist. Darüber hinaus muss man keine riesigen Flightcases mehr durch die Gegend schubsen – alles passt mehr oder weniger in einen mittleren Reisekoffer.
Trotzdem sollte man das sich daraus fast zwangsläufig ergebende Credo aus der Überschrift (frei nach Yngwie Malmsteen) von Zeit zu Zeit kritisch überprüfen. Schlussendlich ist ja unser aller Job die bestmögliche Übertragung des Bühnengeschehens. Dies kann je nach Kontext sowohl „authentisch“, „(sprach-)verständlich“ als auch „druckvoll“, „transparent“ oder aber „nicht zu laut“ (die DIN15905-5 lässt grüßen) bedeuten. Manche Stimmen benötigen hierfür ein De-Essing, andere wiederum nicht. Viele Musikstile kommen ohne Transient-Designer auf der Bassdrum aus, bei einigen macht es aber erst mit richtig Spaß. Und nicht jede Keyboard-Summe bedarf eines Multiband-Kompressors… na ja, vielleicht doch…
Es folgt das Video
https://www.youtube.com/watch?v=